Dossier: Jüdische Zuwanderung ,
"Du bist also jüdisch, oder?" ,
Zum Internationalen Tag der Toleranz am 16. November erklärt Lars Umanski, wie er sich für ein friedliches Miteinander einsetzt, was ihn in seinem Engagement als stellvertretender Vorsitzender der Jüdischen Studierendenunion Deutschland antreibt und wie er sein Jüdischsein lebt.
Die Entscheidung, ob sich Lars Umanski in seiner Kindheit und Jugend zu seiner Religionszugehörigkeit bekennen wollte oder nicht, wurde ihm mehrmals von anderen abgenommen. In einer Telefon-Kontaktliste für Eltern war vermerkt, dass der 1997 geborene Umanski Jude war. Auf dem Gymnasium sprach ihn ein Lehrer in einer Pause darauf an: "Du bist also jüdisch, oder?"
. Danach redete die ganze Klasse von nichts anderem mehr. "Ein Mitschüler kam danach auf mich zu und erklärte mir, dass er kein Problem mit Juden habe. Warum sagt ein Zwölfjähriger so einen Satz?"
, fragt sich Umanski noch heute. Nachdem der Lehrer ihn als Juden vorgestellt hatte, wurde er im Unterricht immer dann aufgerufen, wenn der Nahostkonflikt, der Holocaust und Antisemitismus behandelt wurden. "Genau bei diesen Themen richteten sich alle Blicke erwartungsvoll auf mich"
, erklärt er.
Was sich Umanski noch heute wünscht, ist, dass das jüdische Leben in Deutschland nicht nur auf Shoa oder Nahostkonflikt reduziert wird. "Jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist vielfältig und multiethisch. Dies sollte einfach mehr zur Geltung kommen"
, sagt der junge Mann. Heute setzt er sich unter anderem dafür als stellvertretender Vorsitzender der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD) ein.
Zitat
Jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist vielfältig und multiethnisch. Dies sollte einfach mehr zur Geltung kommen.
Lars Umanski, stellvertretender Vorsitzender der Jüdischen Studierendenunion Deutschland

In seiner Rolle bei der JSUD erlebt der Student oft dieselben Reflexe wie damals in der Schule. "Sobald es einen antisemitischen Vorfall oder einen Shoa-Gedenktag gibt, bittet uns die Presse um eine Erklärung dazu"
, erklärt Umanski, der seit 2016 in Berlin lebt und Jura studiert. Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der JSUD versuchen daher, den Blick auf das Judentum zu weiten. "Empowerte und engagierte junge Jüdinnen und Juden gestalten ein pulsierendes, facettenreiches, sowie nachhaltiges jüdisches Leben in Deutschland und tragen zu einer vielfältigen und hassfreien Gesellschaft bei."
Das ist die Vision der JSUD.
Vielfalt des jüdischen Lebens in die Gesellschaft tragen
"Wir feiern derzeit 1.700 Jahre Judentum in Deutschland. Aber kaum jemand in Deutschland kennt jüdische Kultur"
, bedauert er. Das wolle die JSUD ändern. "Bildung, Bildung, Bildung"
, das sei der wichtigste Baustein, um die Vielfalt des jüdischen Lebens in die Gesellschaft zu tragen. Daher macht sich die JSUD für Reformen im Lehrplan stark und veranstaltet Campustage an Universitäten. "Dort erfahren die Studierenden häufig zum ersten Mal, was wir an Jom Kippur feiern und dass es viele verschiedene Ausprägungen des Judentums gibt – sowie bei den Christen auch."
Die Familie von Lars Umanski stammt aus der Ukraine. Sein Vater arbeitete als Flugzeugbauingenieur, seine Mutter als Maschinenbauingenieurin, die Ukraine bot ihnen jedoch zu wenig Perspektive. Daher beschloss die Familie 1997 auszuwandern. Der heutige Student selbst war damals gerade erst geboren worden. Der Vorname Lars sollte dem kleinen Baby einmal ein leichtes Leben in Deutschland bereiten. Außerdem stand er für das säkulare Judentum, dem die Eltern angehörten. "Meine Eltern haben sich in der Ukraine angewöhnt, ihr Judentum nicht an die große Glocke zu hängen"
, erklärt Umanski, dem seine Eltern eine gewisse Verschwiegenheit in Bezug auf ihre jüdische Existenz mit auf den Weg gegeben haben. "In ihren sowjetischen Pässen stand, dass sie Juden waren. Das hat sie geprägt"
, sagt der Student überzeugt. Und so hat er im Elternhaus mitgenommen, seine jüdische Existenz zwar selbstbewusst, aber nicht öffentlich auszuleben.
Die jüdische Gemeinde als "Safe Space"
Die Quotenregelung führte Familie Umanski nach Unna. Dort ließ sich der Vater zum Zerspanungsmechaniker umschulen. Seine Mutter hatte bereits während der Perestroika eine Ausbildung als Buchhalterin absolviert. "Meine Eltern wollten nichts mehr als sich zu integrieren"
, erinnert sich Umanski. "Für sie war Integration gleichbedeutend mit wirtschaftlicher Unabhängigkeit"
, differenziert er. Schon zehn Jahre nach der Einreise kauften sie sich 2007 ein eigenes Haus. "Mein Vater hat dafür teilweise drei Schichten hintereinander gearbeitet. Manchmal habe ich ihn nur am Wochenende gesehen."
Wie lebt Umanski heute seinen jüdischen Glauben aus? Jeden Freitag trifft er sich zum Shabes-Abendessen und geht an Sabbat und hohen Feiertagen in die Synagoge. Er ist nicht orthodox. Auch trägt Umanski keine Kippa. Seine Davidsternkette hat er aber stets um den Hals. "Sie ist ein Teil von mir. Das ist prinzipiell."
Früher hatte er überhaupt keine Sorgen die Kette offen zu tragen, aber mittlerweile fragt er sich, ob er sie nicht doch lieber versteckt tragen sollte, um Anfeindungen zu meiden. Umanski betont, dass es in Deutschland nicht viele Menschen gibt, die offen eine Kippa oder den Tallit tragen. Die meisten von ihnen, das weiß er, waren deshalb schon Anfeindungen ausgesetzt. Jüdische Feste sind für Umanski ein Safe Space genauso wie der Besuch der Synagoge. "Dort ins man in einer Gemeinschaft und fühlt sich wohl"
, betont er. Auch sonst ist das Judentum ständiger Begleiter in seinem Alltag, ob durch Freunde oder die Studiengemeinschaft, dort fühlt er sich nie fremd.
"Inspiriert durch unsere jüdischen und demokratischen Werte bestärken wir junge Jüdinnen und Juden ihre gesellschaftspolitischen Interessen zu diskutieren, zu bündeln und eröffnen breite Möglichkeiten, diese durch gemeinschaftliches Handeln in jüdische Institutionen als auch in die Gesamtgesellschaft einzubringen."
Dafür setzt sich Umanski gerne ein. Ein junger jüdischer Mann, verankert in der deutschen Gesellschaft.
Broschüre: Die Aufnahme jüdischer Zuwandernder aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion
Die Broschüre gibt einen Überblick über die Zuwanderung jüdischer Menschen nach Deutschland sowie deren geschichtliche Hintergründe.
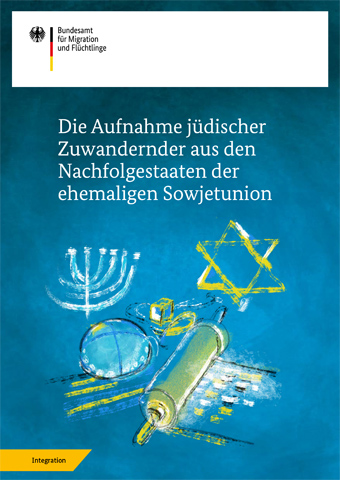
Blätterfunktion
Inhalt
- Das Aufnahmeverfahren jüdischer Zuwandernder aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion
- Das BAMF und die jüdische Zuwanderung
- Grußwort: 1700 Jahre "Jüdisches Leben in Deutschland"
- Zuwanderung bereichert jüdisches Leben
- "Besonderer Stellenwert"
- Virtueller Synagogenrundgang
- Chance für ein lebendiges jüdisches Leben in Deutschland
- "Du bist also jüdisch, oder?"

