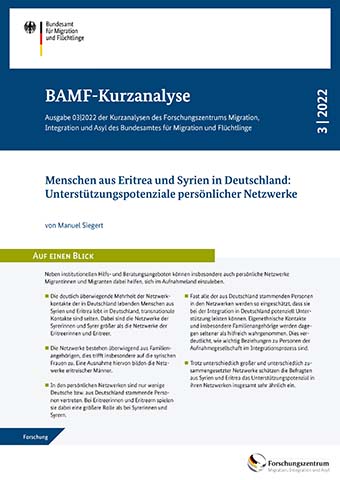Unterstützungspotenzial von Netzwerken Geflüchteter ,
Welche persönlichen Netzwerke haben Geflüchtete, insbesondere Menschen aus Eritrea und Syrien in Deutschland? Aus welchen Personen bestehen sie und welche Unterstützung können Geflüchtete durch sie erfahren? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Dr. Manuel Siegert im Interview. Er ist Autor der neuen BAMF-Kurzanalyse 3|2022 "Menschen aus Eritrea und Syrien in Deutschland: Unterstützungspotenziale persönlicher Netzwerke".
Wer sich in einem unbekannten Umfeld zurechtfinden muss, ist meist auf die Unterstützung anderer angewiesen. So gibt es für geflüchtete Menschen verschiedene staatliche und zivilgesellschaftliche Hilfs- und Beratungsangebote, um das Einleben, Ankommen und die Teilhabe hierzulande zu erleichtern. Aber auch persönliche Netzwerke, wie beispielsweise Kontakte zu Bekannten, Freunden und Familienangehörigen, können eine wichtige Stütze sein. Welches Unterstützungspotenzial persönliche Netzwerke für Geflüchtete - insbesondere für Menschen aus Syrien und Eritrea in Deutschland - haben, hat Dr. Manuel Siegert, wissenschaftlicher Mitarbeiter im BAMF-Forschungszentrum, auf Basis der "TransFAR-Studie" untersucht.
Herr Siegert, wie groß sind die Netzwerke der Menschen aus Eritrea und Syrien und was können sie leisten?
 Dr. Manuel Siegert
Quelle: © BAMF
Dr. Manuel Siegert
Quelle: © BAMF
Dr. Manuel Siegert: Die Größe der persönlichen Netzwerke variiert leicht zwischen den syrischen und eritreischen Männern und Frauen. Grundsätzlich sind die Netzwerke der Syrerinnen und Syrer etwas größer als die Netzwerke der Eritreerinnen und Eritreer. Die Größe variiert zwischen durchschnittlich vier Personen bei den eritreischen Frauen und durchschnittlich fünf bei den Frauen aus Syrien.
Die persönlichen Netzwerke können den Menschen aus Syrien und Eritrea dabei helfen, sich in Deutschland einzuleben. Familienangehörige, Freunde und Bekannte, die zusammen das persönliche Netzwerk einer Person bilden, bieten zum Beispiel emotionale Nähe, stellen Informationen, Geld oder andere Güter bereit und helfen bei unterschiedlichen Aufgaben wie der Betreuung von Angehörigen oder übernehmen Renovierungsarbeiten bei einem Umzug.
Wie unterscheiden sich die Netzwerke der beiden untersuchten Gruppen voneinander?
Dr. Siegert: Die Netzwerke der Menschen aus Syrien und Eritrea unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihrer Größe, aber auch hinsichtlich ihrer Zusammensetzung. Bei den meisten bestehen sie überwiegend aus Familienangehörigen, insbesondere bei den syrischen Frauen. In den Netzwerken der eritreischen Männer sind dagegen vergleichsweise wenige Familienangehörige. Dafür sind bei den eritreischen Männern mehr Deutsche im Netzwerk als bei den syrischen Frauen. Doch obwohl sich die Netzwerke der untersuchten Gruppen unterscheiden, nennen sie jeweils ähnlich viele Personen, die bei unterschiedlichen Herausforderungen helfen könnten und würden. Aufgrund der Unterschiede bei den Netzwerken hatte ich das nicht erwartet. Anscheinend gelingt es den Betroffenen aber, auf unterschiedlichen Wegen und unter unterschiedlichen Bedingungen ein potenziell hilfreiches Netzwerk aufzubauen, was erstmal eine gute Nachricht ist.
Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus für die Integrationsförderung ziehen?
Dr. Siegert: Beziehungen zu Personen, die aus Deutschland stammen, scheinen besonders hilfreich zu sein. Dies war zu erwarten, da sich diese Personen am meisten mit den Gegebenheiten und Gepflogenheiten in Deutschland auskennen und daher bei Herausforderungen, die das Einleben in Deutschland betreffen, am meisten helfen können sollten. Aus dem jeweiligen Herkunftsland stammende Personen und insbesondere Familienangehörige werden dagegen deutlich seltener als potenziell hilfreich eingestuft. Familienangehörige sind aber vor allem immer dann wichtig, wenn die benötigte Hilfe viel gegenseitiges Vertrauen voraussetzt.
Insgesamt verdeutlichen diese Ergebnisse, wie wichtig es ist, Möglichkeiten für Begegnungen und Austausch zwischen Alteingesessenen und neu zugewanderten Menschen zu schaffen, damit sich ein Beziehungsgeflecht zwischen diesen beiden Gruppen entwickeln kann. Besonders Angebote, die sich speziell an Frauen richten, sind wichtig, da sie noch nicht so stark am Arbeitsmarkt aktiv sind wie die Männer, die dort häufig Kontakte knüpfen können.
Die "TransFAR-Studie"

In Kooperation mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung führt das BAMF-Forschungszentrum das Forschungsprojekt "Forced Migration and Transnational Family Arrangements: Eritrean and Syrian Refugees in Germany", kurz "TransFAR", durch.
Zielsetzung ist es, die familiäre Situation und die soziale Einbindung kürzlich zugewanderter Menschen aus Syrien und Eritrea zu untersuchen. Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden 1.458 Personen aus Syrien und Eritrea in Deutschland im Jahr 2020 befragt. Mit den gewonnenen Daten lassen sich die persönlichen Netzwerke der Menschen aus Syrien und Eritrea hierzulande analysieren. Es stehen umfangreiche und bisher einmalig detaillierte Informationen zum Thema bereit. Dadurch ist es möglich, denn Kenntnisstand zu den persönlichen Netzwerken insbesondere der Menschen aus Syrien und Eritrea in Deutschland zu vertiefen.
Unterstützungsnetzwerke von Menschen aus Eritrea und Syrien in Deutschland
In der BAMF-Kurzanalyse 3|2022 werden die persönlichen Netzwerke der in Deutschland lebenden Menschen aus Syrien und Eritrea und das darin enthaltene, von den Betroffenen wahrgenommene Unterstützungspotenzial untersucht.